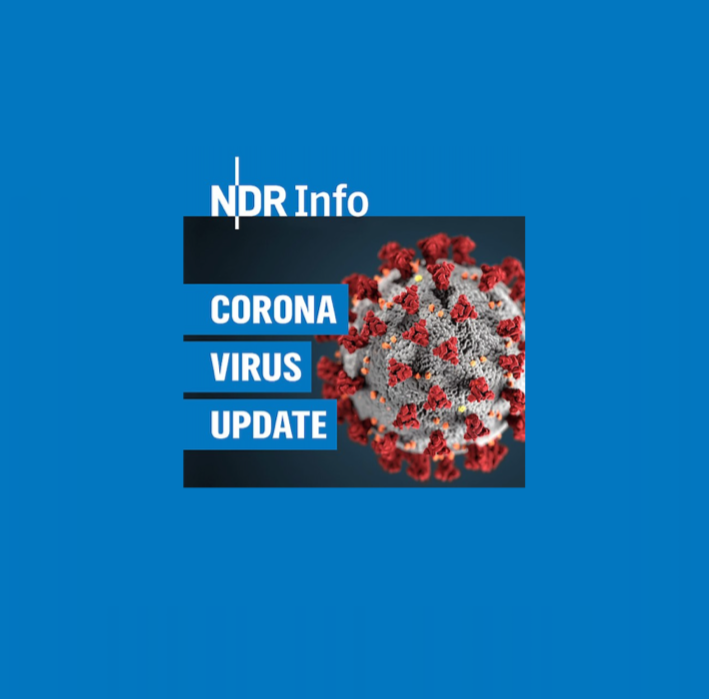Forschung zwischen Popularität und Reputation: Risiken der Wissenschaftskommunikation (Teil 2)

[Dieser Beitrag in der Reihe „Populäre Expertise“ erscheint parallel auf dem KWI-Blog und auf dem Blog des SFB 1472 „Transformationen des Populären“.]
Die Problematik verschiedener Popularitätsregime in der Wissenschaft und in den Massenmedien ist noch längst nicht scharf genug herausgearbeitet worden, und die Wissenschaftsorganisationen scheinen bislang vor allem der Ansicht zu sein, dass es allein darauf ankomme, nun auch die Wissenschaftskommunikation zu professionalisieren. Expertïnnen sollen die Wissenschaft so vermitteln, dass sie beim Publikum ankommt.
Das lässt sich studieren:
„An Wissenschaftler*innen wird oft kritisiert, dass sie eine Sprache sprechen, die nicht jede*r versteht. Auch scheint es so, als würde so manche wissenschaftliche Forschung kein öffentliches Interesse finden oder aber, dass wissenschaftliche Entdeckungen und Innovationen unseren Alltag so schnell auf den Kopf gestellt haben, dass sie nicht mehr nachvollziehbar sind, uns überfordern und bei manchen sogar auf Misstrauen oder Ablehnung stoßen. Genau an dieser Stelle setzen Wissenschaftskommunikator*innen an: Sie wollen Wissenschaft verständlich machen, damit Wissenschaft und Öffentlichkeit, aber auch Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen miteinander in Dialog treten können.
Im Grunde umfasst Wissenschaftskommunikation alles, was wissenschaftliche Sachverhalte in eine für Laien verständliche Form bringt: öffentliche Vorträge von Wissenschaftler*innen, populärwissenschaftliche Sachbücher und Ratgeber, Wissenszeitschriften, TV- und Hörfunksendungen, Museen, Planetarien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Blogs, Podcasts, Erklärvideos, Aufklärungskampagnen, Wissenschaftswettbewerbe, Schüler*innenlabore und vieles mehr."1
Und das lässt sich trainieren:
„Als Forscher:in haben Sie gelernt, sich in der Fachsprache Ihres Forschungsgebiets auszudrücken. Sie wissen, was gute Vorträge auf Konferenzen auszeichnet und veröffentlichen Ihre Erkenntnisse in Fachpublikationen.
Aber können Sie Ihre Forschungsarbeit auch in drei Sätzen einem Laien erklären, etwa beim Partygespräch? Halten Sie sich für ausreichend geschult, in einen Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten, in einer allgemein verständlichen Sprache zu schreiben oder vor einem Mikrofon oder einer Kamera ihre Wissenschaft zu erläutern?
Die Seminare unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Kommunikationskompetenzen zu vervollkommnen.“2
Die Aufgaben von Wissenschaftskommunikation sind hier sehr gut beschrieben. In „drei Sätzen“ einem „Laien“ zu erklären, was die eigene „Forschungsarbeit“ ausmacht. Dass dabei keine Sprache gesprochen werden darf, die „nicht jede*r versteht“, versteht sich. Um „öffentliches Interesse“ zu finden und in der „Öffentlichkeit“ so zu kommunizieren, dass ein „Dialog“ entsteht, also die Rezipientïnnen bei der Stange bleiben und nicht umschalten, abschalten oder umblättern, bedarf es also „persönlicher Kommunikationskompetenzen“, die nichts mit dem zu tun haben, was die „Forscher:in“ bereits „gelernt“ hat, nämlich zu forschen, oder es bedarf eigens ausgebildeter „Wissenschaftskommunikator*innen“, die es der „Forscher:in“ abnehmen, selbst Aufmerksamkeit zu finden und mit der Öffentlichkeit „in einer allgemein verständlichen Sprache“ zu kommunizieren. Die Profis helfen dabei, Forschung „nachvollziehbar“ zu machen und zu verhindern, dass „Entdeckungen und Innovationen“ in der Öffentlichkeit „auf Misstrauen oder Ablehnung stoßen“.
Diese Studien- und Trainingsprogramme denken Wissenschaftskommunikation allein von der Seite der Wissenschaften aus. Ihre Aufgabe sehen sie in der interessanten und verständlichen Vermittlung von Expertise. Auf den Partner im gewünschten „Dialog“, auf die Rezipientïnnen der Wissenschaftskommunikation, wird nicht eingegangen – ganz als würde die „Sendebereitschaft“ schon genügen, um „Einschaltinteresse“ zu erzeugen, um es mit Niklas Luhmann zu formulieren.3 Nimmt man einmal die Laien in den Blick, die ja zuallererst für Wissenschaftskommunikation interessiert werden müssen, dann steht bei aller empirischen Diversität und Heterogenität zumindest fest, dass das Gegenüber der „Forscher:in“ beim „Partygespräch“ oder das Publikum einer „TV- und Hörfunksendung“ über keine fachliche Expertise verfügt. Es kann die dargebotenen „drei Sätze“ oder auch fünfzehn Minuten nicht lege artis (wie die DFG es nennt, wenn sich Forschung auf der Höhe der Standards eines Fachs bewegt) beurteilen; es kann auch keine eigene Quellenrecherchen und Überprüfungen betreiben; es kann nur eines tun: darauf zu vertrauen, dass das, was ihm da vermittelt werden soll, auch zutreffe, und das, wofür es begeistert werden soll, schon stimme. Wissenschaftskommunikation ist auf das Vertrauen in die Wissenschaften angewiesen, und da Wissenschaftskommunikation meistens sehr konkret mit ganz bestimmten Fächern und Forschungsgebieten zu tun hat, bedeutet dies, dass sie auf das Vertrauen in ganz konkrete Wissenschaftlerïnnen angewiesen ist. Es ist die Reputation der Wissenschaftlerïnnen, die dafür den nötigen Vertrauensvorschuss liefert.
Das klingt einfach: Von einem bedeutenden Fachvertreter, von einer renommierten Expertin genügen dann auch ein paar Sätze in der richtigen Mischung von Fachterminologie und prägnanten Bildern, dann gelingt die Wissenschaftskommunikation und die Öffentlichkeit weiß, was sie von einer Sache zu halten hat. Doch so einfach ist es leider nicht, denn es ist einerseits nicht zu verhindern, dass Wissenschaftskommunikation in der medialen Anschlusskommunikation „verballhornt“ wird und zu „Irrtümern“ führt, also zu nicht intendierten Fehlrezeptionen. Und es ist ebenso wenig auszuschließen, dass gut gemachte Wissenschaftskommunikation auch dann erfolgreich ist, wenn der Wechsel auf die Reputation nicht gedeckt ist, und zwar aus dem Grunde, dass der Mix aus Jargon und Rhetorik gelungener ist und beim Gegenüber besser ankommt als andere Angebote im Portfolio der Wissenschaftskommunikation. Es ist gar nicht so selten, dass nicht die Position populär wird, die allen Kriterien der Forschung lege artis am besten standhält und deren Erkenntnisgewinn für die Wissenschaften unbestritten ist, sondern solche Ansichten, die in der „Öffentlichkeit“ oder bei den „Laien“ am meisten Beachtung finden, weil sie besser „rüberkommen“. Die Formseite hat dann die Sachdimension der Wissenschaftskommunikation aus dem Rennen geworfen. Die gute Vermittlung ist etwas völlig anderes als die Vermittlung des Guten. Und auch bei der Kommunikation über Wissenschaft kommt es auf etwas anderes an als bei wissenschaftlicher Kommunikation.
Das wissen die Sichtbarkeits-, Vermittlungs- und Popularisierungsexpertïnnen natürlich auch. Dass die studierten Expertïnnen der Wissenschaftskommunikation der wissenschaftlichen Expertise der Forschenden zwangsläufig laienhaft gegenüberstehen, wird jedoch ausgeblendet. Auch sie müssen, wie das große Publikum, vertrauen, der Reputation der Wissenschaftlerïnnen und ihrer Einrichtungen. Das Grundproblem, dass sich gerade die hohe Komplexität einer hochspezialisierten Expertise nur reduzieren lässt, wenn auf das verzichtet wird, was ihre Wissenschaftlichkeit ausmacht, wird nicht einmal benannt.
Damit Laien, die kein langjähriges wissenschaftliches Training in einem bestimmten Fach erhalten und keine Forschungsarbeit in diesem Fach geleistet haben, dennoch über neueste Forschungsentwicklungen und Hypothesen sprechen können, müssen sie sich ganz und gar darauf verlassen, dass das Versprechen, das die Wissenschaftskommunikation unterbreitet, gehalten wird. Dazu wird auf Reputation zurückgegriffen, die als „Nebencode“ des Wissenschaftssystems fungiert und Erkenntnisgewinne auf natürliche und juristische Personen zurechenbar macht. Mit den „Trägern von Reputation“ lässt sich, anders als mit dem Wissenschaftssystem als Funktionssystem der Gesellschaft, „direkt kommunizieren“4. Die Forscherïnnen und ihre Einrichtungen lassen sich adressieren – und reagieren womöglich in Form von Pressemitteilungen oder Statements, Tweets, Blogs oder Podcasts, Interviews und Talks. Genau wie die wissenschaftliche Kommunikation von der Wissenschaftskommunikation unterschieden werden muss, müssen auch die Reputationsmechanismen der Wissenschaft von ihrer primären Funktion, dem „Gewinnen neuer Erkenntnisse“, unterschieden werden, wie Niklas Luhmann argumentiert5. Es liegt nahe, auf Reputation zu setzen, wenn die Wissenschaftskommunikation einen „Dialog mit der Öffentlichkeit“ installiert, weil ihre Träger sichtbar gemacht und Einschätzungen, Bilder, Statements mit einem Eigennamen versehen und in mediale Zirkulation gebracht werden können.
Diese Zirkulation folgt nicht den Bedingungen wissenschaftlicher, sondern medialer Kommunikation, doch werden die hier entstehenden Meinungsbilder und Einschätzungen den Personen zugerechnet. Die medial kursierenden Einschätzungen der Forscherinnen und Forscher, seien sie positiv, seien sie negativ, sind kein Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung, sondern ein Ergebnis der Wissenschaftskommunikation, die diese Forschung sichtbar macht. Dennoch lässt dies alles die Reputation der Forscherïnnen nicht unberührt, weil auch die Effekte der Wissenschaftskommunikation den Personen, deren Eigennamen in den Medien zirkulieren und die in den Medien mit bestimmten Meinungen, Thesen, Warnungen oder Lageeinschätzungen verbunden werden, zugerechnet werden können. Während der innerwissenschaftliche Reputationsaufbau, der über Forschung und Erkenntnisgewinn läuft, gar nicht berührt ist, kann der „Dialog mit der Öffentlichkeit“ der Reputation nutzen oder schaden, je nachdem, ob dieser Dialog aus allen nur möglichen Gründen, die aber mit Forschung und Erkenntnisgewinn nichts zu tun haben, gelingt oder scheitert.
Der Wunsch nach Expertise wird von außen an die wissenschaftlichen Einrichtungen herangetragen und stellt diese vor besondere „Herausforderungen an die Wissenschaftskommunikation“, lässt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina verlauten:
„Immer häufiger melden sich Wissenschaftler zu Wort – weil sie ihre Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit vermitteln wollen, sie ihre Expertisen an die Politik geben oder ganz einfach, weil sie tagtäglich von Journalisten zu unzähligen Themen um ihre zitierfähige Einschätzung gebeten werden."6
Wissenschaftskommunikation reagiert demnach also auf eine tagtägliche Nachfrage nach Expertise zu „unzähligen Themen“. Die Gesellschaft bedarf nicht nur der Forschung, sondern wünscht sich auch die Vermittlung und Kommentierung dieser Forschung. Die „zitierfähige Einschätzung“, nach der hier verlangt wird, kann nur aus einem Prozess der Komplexitätsreduktion hervorgehen. Die zitablen „Expertisen“ lassen sich massenmedial wie in sozialen Medien weiterverwenden und sind durch die hohe Reputation der Akademiemitglieder gedeckt. Die größte Sorgfalt bei der Formulierung einer „zitierfähigen Einschätzung“ wird aber nichts daran ändern können, dass die Rezipientïnnen Laien sind. Was die Laien selbst beurteilen können, fällt auf die Mitteilungsseite der Kommunikation; was die mitgeteilte Information angeht, müssen die Laien der Reputation des Experten vertrauen, der die Information mitteilt. Es ist naheliegend zu fordern, man möge doch bitte den Fakten vertrauen oder den zutreffenden wissenschaftlichen Schlussfolgerungen, doch kann in der Wissenschaftskommunikation gerade auch die Form der Mitteilung Vertrauen (oder Misstrauen) für die Botschaft erwecken, wenn sie nur entsprechend gestaltet ist – und es ist daher wahrscheinlich, dass Vertrauen fehlinvestiert wird: etwa wenn eine gut gemachte Kampagne der Wissenschaftskommunikation langfristig ohne wissenschaftliche Deckung bleibt; wenn sozusagen die Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation erfolgreicher ist als die „Forschungsergebnisse“, die der Öffentlichkeit versprochen werden. Ein Beispiel wäre dafür die Tätigkeit der Berliner Agentur Storymachine im Zuge ihrer Begleitung der sogenannten Heinsberg-Studie. Gerade die Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation im Dienste der Sichtbarkeit der Forscherïnnen und ihrer Institutionen birgt das Risiko, dass Erfolge auf der Mitteilungsseite erzielt werden und hohe Resonanz erreicht wird, ohne dass Forschungsergebnisse und Erkenntnisgewinne mithalten können. Und wenn es sich umgekehrt verhält, dass die Forschung großartig ist, im „Dialog mit der Öffentlichkeit“ aber nicht gut ausschaut, dann wird auf der Seite der Mitteilung nachgeschärft, um mit noch besserer Wissenschaftskommunikation Vermittlungserfolge zu erzielen und sichtbar zu werden. Investiert wird dann konsequenterweise in die Wissenschaftskommunikation, nicht in die Wissenschaften. Vorstellbar wäre es, dass in einer derart erfolgreich professionalisierten Wissenschaftskommunikation Popularität und Reputation im Lichtkegel der öffentlichen Beachtung zur Deckung kommen. Das Verhältnis zur Forschung, die mit den entsprechenden bekannten und renommierten Eigennamen verbunden ist, wird vermutlich kontingent sein. Darin besteht ihr Risiko.
Niels Werber ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Siegen. Er ist Sprecher des DFG Sonderforschungsbereichs 1472 „Transformationen des Populären“ und Leiter des Teilprojekts A01 „Serienpolitik der Popästhetik: Superhero Comics und Science-Fiction-Heftromane“ (mit Daniel Stein)."
Anmerkungen
1https://www.uni-potsdam.de/de/praxisportal/berufsorientierung-arbeitsmarkt/berufsfelder/forschung-und-wissenschaft/wissenschaftskommunikation, abgerufen am 2.12.2021.
2https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/fuer-gefoerderte/zusatzleistungen-und-weiterbildung/medientraining-fuer-gefoerderte, abgerufen am 2.12.2021.
3Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien, Opladen 1996, S. 12.
4Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1992, S. 246f.
5Ebd. S. 355.
6https://www.leopoldina.org/presse-1/pressemitteilungen/pressemitteilung/press/2100/, abgerufen am 2.12.2021.