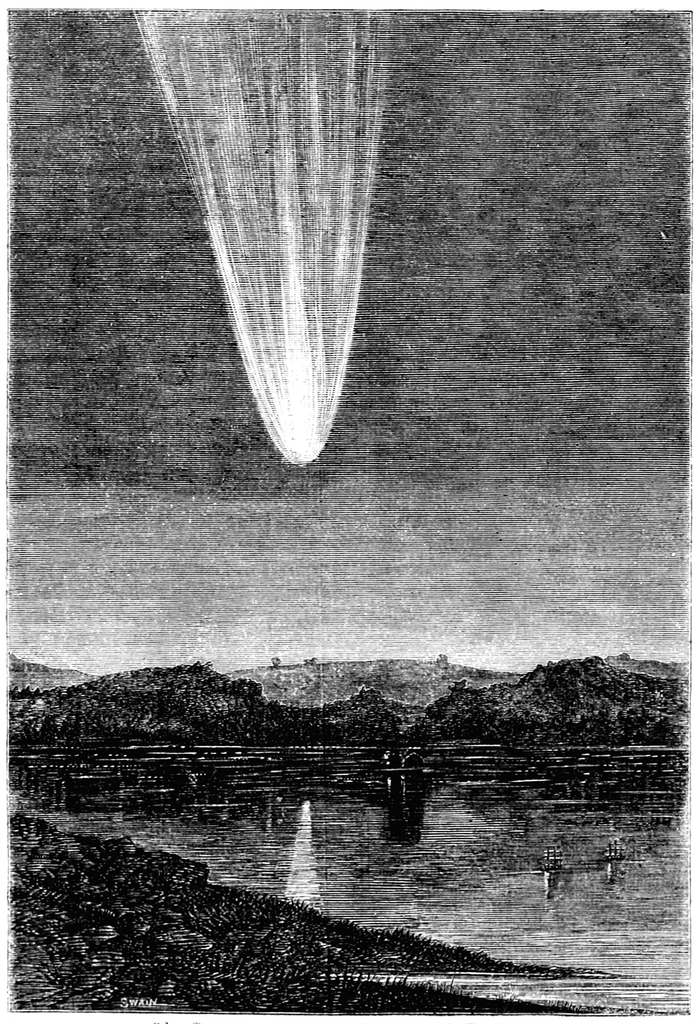Katastrophen-Kommunikation als Kommunikations-Katastrophe

[Don’t Look Up ist trotz oder gerade wegen seiner zynischen und schwarzhumorigen Darstellung eines Totalversagens der Menschheit im Angesicht des drohenden Weltuntergangs eine der erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten. In dieser Blog-Serie (im Rahmen der Reihe „Populäre Expertise“) befassen sich vier Wissenschaftler*innen des neu gegründeten Rhine-Ruhr Center for Science Communication Research aus unterschiedlichen Disziplinen (Tobias Kreutzer, Frauke Domgörgen, Aleksandra Vujadinovic und Julika Griem) mit verschiedenen Aspekten der Wissenschaftskommunikation in Don’t Look Up. Dieser Beitrag erscheint parallel auf dem KWI-Blog und dem Blog des SFB 1472 „Transformationen des Populären“.]
I. Lachen als Rettung?
Am 13. Januar 2022 formulierte der Regisseur Adam McKay gemeinsam mit Elizabeth Johnson nachträglich die politische und strategische Agenda seines Films:
Don’t Look Up tries to do something that perhaps doesn’t feel natural with a story as dark as climate change: make the audience laugh. Because when people laugh together it gives them perspective, relief and, most of all, a semblance of community. This is not conjecture. Research shows that humor can lower our defenses and make hard truths easier to hear. Hopefully comedy can help elucidate how our culture of swipes, clicks and likes is taking us further and further away from the one subject we must talk about. Corporations, advertising and PR firms are turning even the most basic exchange of information into a sales pitch or “brand enhancement” and it’s put us in a very dangerous place. What better way to rob this constant churning wall of spin, coercion and success porn than by simply laughing at it? (…) We need all manner of compelling creations to reach all types of folks.1
Der Regisseur und die Kommunikations-Expertin empfehlen eine Diversifizierung rhetorischer und affektiver Mittel, um die Gemeinschaft der Veränderungswilligen auf humorvolle Weise zu erweitern. Innerhalb der Filmerzählung von Don’t Look Up wird das didaktisch instrumentalisierte Lachen durch eine Reihe von Schlüsselszenen gesteuert, in denen Kommunikation jeweils im Zentrum steht: McKays Klima-Parabel im Modus einer Parodie des Katastrophenfilm-Genres kann auch als eine geschickt montierte Ketten-Reaktion betrachtet werden, mit der wir aufgefordert werden, exponierte Episoden als Exempla für Wissenschaftskommunikation zu bewerten.
II. Kontrastive Anatomie der Wissenschaftskommunikation
In einer frühen Schlüsselszene sehen wir Dr. Mindy im Kreis von Promovierenden kurz nach Dibiaskys Entdeckung des Kometen. Der Film greift hier ein wirkmächtiges Bild naturwissenschaftlicher Forschung auf. Mindy ist zwar kein preisgekrönter Mathematiker an der klassischen schwarzen Tafel, aber seine Mitarbeiter*innen scharen sich doch mit jener faszinierten Aufmerksamkeit um die auf das Whiteboard geschriebenen Formeln, wie sie für dieses ikonische Ensemble konstitutiv ist: Die begabte Jugend folgt den Kritzeleien ihres Meisters und demonstriert damit die Kohäsion einer eingeschworenen Gemeinschaft von Erkenntnissuchenden. Zu Beginn des Films erscheint die Rollenverteilung in diesem Gruppenbild wissenschaftlicher Selbst- und Fremdbeschreibung noch intakt: Die Doktorand*innen folgen Mindy, und dieser wiederum Carl Sagan, dem Übervater einer erfolgreich popularisierten Astronomie, der in Form einer kleinen Plastikfigur angerufen wird.2
Zu Beginn darf Mindy es sich noch leisten, in seiner mündlichen Kommunikation unbeholfen zu agieren; der Film gestattet es ihm für sehr kurze Zeit, mit freundlicher Konfusion auch Genialität aufzurufen. Diese Konvention der Wissenschaftsvermittlung wird allerdings schnell als Abziehbild entlarvt und Mindy als nicht mehr publizierender Forscher auf sein Mittelmaß zurechtgestutzt. In einer Kontrast-Episode zur Eröffnungsszene hält sich der Astronom gegenüber der Präsidentin im Weißen Haus an einem kleinen Notizbuch fest, das ihm gerade nicht dabei hilft, den beunruhigenden Fund überzeugend darzustellen – hier scheitert er zum ersten Mal daran, einem nicht wissenschafts-affinen Publikum innerhalb und außerhalb des Films „eine einfache Geschichte ohne Mathe“ zu erzählen. In diesen beiden frühen Episoden werden also zwei Formen handschriftlicher Kommunikation so kontrastiert, dass das Kritzeln des Wissenschaftlers seinen Nimbus verliert: Was zunächst Kommunikation unter peers zu sichern scheint und dann angesichts des bedrohlichen Befunds unterbrochen wird, scheitert später so, dass wir nicht mehr nur mit, sondern auch über Dr. Mindy lachen.
Im Verlauf von Don’t Look Up werden exemplarische kommunikative Szenarien erweitert und polarisiert. Dabei bewegt sich die Erzählung der nahenden Katastrophe zunächst von mündlichen Präsenzsituationen im kleinen Kreis zu maschinengestützter Massen-Kommunikation einer unübersichtlichen Gesellschaft, in der immer isoliertere Gemeinschaften aneinander vorbeireden. Die Social Media-Kommunikation der kommerziellen Anbieter steht im Zentrum der Aufmerksamkeit: Immer wieder folgen auf Mindys und Kates Akte scheiternder Wissenschaftskommunikation (z. B. in einer Zeitungs-Redaktion und einer Fernsehsendung) Kaskaden einmontierter Twitter-Kommentare, mit denen die Dynamik algorithmisch gestützten Schreibens und Kommentierens als sachfremd und unkontrollierbar präsentiert wird. Die in vielen Foren und ‚Denkfabriken‘ der Wissenschaftskommunikation diskutierte Alternative einer sachdienlichen Nutzung von digitalen Formaten ignoriert McKays Film, um sich einer Fundamentalkritik des Plattform-Kapitalismus widmen zu können.
Kurz vor dem Einschlag des Kometen kommt es allerdings zu einer Re-Inszenierung gemeinschaftsstabilisierender Mündlichkeit. Im Angesicht des nun fast sicheren Untergangs versammeln sich der heimkehrende Ehebrecher Mindy sowie Kate und ihr Skater-Freund Yule, gespielt vom Kino-Liebling Timothée Chalamet, im Haus des Astronomen in Michigan. Die wiedervereinigte Kernfamilie, erweitert um ihre Patchwork-Mitglieder Kate und Yule, trifft sich zu einem letzten Abendmahl: Man blickt auf ein gutes Leben zurück, wertschätzt das frisch zubereitete Essen und reicht sich die Hände, um den neugefundenen Bund der gescheiterten wissenschaftlichen Rationalität mit einem Gebet des Skaters zu stärken, der evangelikal erzogen wurde. Dr. Mindy darf in dieser finalen Apotheose erdverbundener Solidarität zu seiner Unbeholfenheit zurückkehren, nachdem er vorübergehend zu einem geschmeidig formulierenden TV-Wissenschaftler im Dienst des Weißen Hauses mutiert war. Nun übernimmt der sympathische junge Aussteiger die kommunikative Führung und evoziert damit die Bewegung der „Young Evangelicals for Climate Action”, mit der sich Hoffnungen auf eine Überwindung der politischen Spaltung in den USA zumindest in einzelnen Milieus verbinden.3 Die Sepia-Töne in der mise-en-scène im Haus der Mindys tauchen das Weltende in einen nostalgischen Abschiedsschmerz, mit dem zumindest die Idee einer Gemeinschaft im Zeichen des Respekts vor dem Planeten Erde zu überleben scheint.4 Als ein Leitmotiv des Films erhält die Nahrungsaufnahme über die religiöse Ikonographie hinaus eine sinnstiftende Funktion: In einigen Kontrast-Szenen im Weißen Haus – inszeniert als aus dem Ruder gelaufener Gegen-Ort zum bescheidenen Heim der Mindys im Mittleren Westen – wird Mindy und Kate fast food aus dem Automaten vor die Füße geworfen, nachdem ein General ihnen zuvor für die ungesunden Gratis-Snacks sogar Geld abgenommen hatte.
Eine bisher kaum thematisierte Aufgabe übernehmen innerhalb der kommunikativen Dramaturgie von Don’t Look Up Sequenzen, in denen nicht-menschliche Bewohner*innen unseres Planeten in der Bildsprache glamouröser Natur-Dokumentationen im Stil der BBC-Reihe The Blue Planet zu sehen sind. Diese Lebewesen spielen eine Doppelrolle für das normative Projekt des Films: Blickt man von der Abendmahlsszene zurück, werden sie zu Mitgliedern jener planetarisch-achtsamen Großfamilie, für die der Mensch im Anthropozän seine Empathie dringend trainieren muss, um zu retten, was aus christlicher Perspektive als Schöpfung gilt. Im Kontext der kontinuierlichen Kritik an kommerziell motivierter Netzkommunikation mobilisiert McKays Film die faszinierend schönen Bilder nicht-menschlicher Mitgeschöpfe als gezielt irritierende Stolpersteine im Rezeptionsprozess; als stumme Zeugen einer scheiternden spezies-übergreifenden Kommunikation und unschuldige Opfer einer asymmetrischen Interaktion, in der Vertreter der menschlichen Spezies die Zukunft des Planeten ihren Profitinteressen unterordnen, ohne die Bedürfnisse anderer Arten zu berücksichtigen.
Als Inkarnation dieser Haltung dient die von Mark Rylance gespielte Figur des Sir Christopher Isherwell, einer Collage der soziopathischen Marotten von tech bros wie Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Peter Thiel und vor allem Jeff Bezos und Elon Musk. Sir Christopher präsentiert seine imperialen Fantasien als Weltverbesserung, mit der sich ökonomischer Profit und ökologische Prävention nicht mehr ausschließen müssten. Um diese ‚Vision‘ im Angesicht des nahenden Kometen geschäftsfördernd realisieren zu können, greift der Platin-Spender der Präsidentinnen-Partei auf eine Kulturtechnik zurück, die Lorraine Daston und Peter Galison als bedeutsames kommunikatives und performatives Instrument zur Herstellung von Objektivität rekonstruiert haben:5 Sir Christopher errichtet für die politischen Entscheidungsträger eine Versuchsanordnung zur Demonstration der nano-technologisch basierten Zerkleinerung des Kometen, die das in dieser Szene versammelte Publikum mit Hilfe von Hologramm-Effekten in fasziniertes Staunen versetzt. McKay zitiert hier nicht allein die Wissenschaftsgeschichte des Experiments vor Publikum, das zu rhetorisch und ästhetisch induzierter Überzeugung geführt wird. Die dreidimensionale Animation erinnert zudem an unzählige populäre Filme, in denen vor allem die Natur-, Technik und Lebenswissenschaften mithilfe spektakulär inszenierter Visualisierungen weniger erklärt als vorgeführt werden. Sir Christopher bedient sich dieser Überwältigungs-Ästhetik virtuos, und sein wissenschaftlich uninformiertes Publikum reagiert wie geplant.
Innerhalb der Erzählanlage von Don’t Look Up kann diese Schlüsselszene mit der Eingangs-Situation in Mindys und Dibiaskys Labor verglichen werden, denn beide Episoden setzen, wenn auch auf unterschiedliche Weise, auf Potentiale mündlicher Wissenschaftskommunikation. Zeigte sich zu Beginn des Films noch eine scheinbar intakte forschende Gemeinschaft in physischer Präsenz, ungestört von Außenstehenden, für die übersetzt werden muss, zersetzt die durchgeplante Demonstration des Tech-Milliardärs die vereinheitlichende Idealvorstellung einer scientific community, die politische, ökonomische sowie kulturelle Grenzen und Ungleichheiten transzendiert: In McKays Film wird früh deutlich, dass diese Gemeinschaft sich angesichts des drohenden Einschlags nicht zuverlässig mobilisieren lässt, und im staunenden Kreis von Sir Isherwoods dubioser Vorführung wirkt auch eine Nobel-Preisträgerin mit, die Dr. Mindy in seiner korrumpierten Phase um ihre Ressourcen beneidet.
III. Am Ende?
Als Filmerzählung operiert Don’t Look Up mit mehrfachen Rahmungen auf verschiedenen Ebenen. Dies zeigt sich besonders deutlich an der hinausgezögerten Schlussbildung des ohnehin überlangen Films. So machen zwei nachgereichte Schluss-Szenen jede Hoffnung auf einen finalen Twist zunichte: Im ersten ‚Nachklapp‘ bestätigt sich die Unfähigkeit zur speziesübergreifenden Kommunikation, indem die Präsidentin, Mitglied der exklusiven Rettungsreisegruppe Sir Christophers, in einer sarkastischen Simulation des Gartens Eden jenseits der Erde von einem unbekannten Lebewesen totgebissen wird, weil diese schöne neue Welt doch kein Streichelzoo ist. Offenbar reichte es McKay nicht, mit dieser Szene auch die Schwund-Dyade von Mutter und Sohn zu zerstören, dem negativen Gegenentwurf zur Wissenschaftler-Familie um Dr. Mindy und Kate. Denn in der letzten Einstellung des Films überlebt auf der zerstörten Erde ausgerechnet der bräsig-parasitäre Präsidentensohn. Am Ende des Endes kriecht er unter den Trümmern hervor, produziert ein Selfie und liefert mit diesem solipsistischen Akt den letzten Beleg einer zum Untergang verurteilten Menschheit, die mit ihrer Rationalität und Empathie auch das Recht verloren zu haben scheint, die Katastrophen zu überleben.
Mit dieser Schlusseinstellung stellt Don’t Look Up noch ein letztes Mal die Frage, wer in diesem Film wem zuhört und zuschaut. Der Präsidentensohn mag uns als groteske Witzfigur innerhalb einer Kulmination von wissenschaftskommunikativen Pleiten und Pannen erscheinen, aber wir sind als sein didaktisch provoziertes Ebenbild noch im Spiel der Erzählung:
You see, when it comes to climate change, we are all in the writers’ room right now, deciding how the story unfolds and how it ends. And that story can be funny, dire, hopeful or all of the above. But not every story is guaranteed a happy ending, even though that’s mostly what we see in movies. So we can’t just sit back and watch. We are not an audience. Like it or not, we are in this story.6
McKays Wissenschaftserzählung arbeitet also mit kommunikativen Szenarien, aus denen das Filmpublikum sich nicht herausstehlen kann: Wir gehören zum erweiterten Kreis der Zuschauer*innen von Sir Christophers Überwältigungsanordnung, weil wir uns an das Faszinationsmanagement, an den „success porn“ kommerziell geprägter Wissenschaftskommunikation längst ebenso gewöhnt haben wie an die hochaufgelösten Dokumentaraufnahmen bedrohter ambassador animals in den heroischen Erzählungen den Planeten erkundender Naturforscher. Betrachtet man, mit einem Schritt aus der erzählten Filmwelt hinaus auf die Ebene der Strategien seiner Erzählung, Don’t Look Up als eine sarkastische Mobilisierung nicht nur von Konventionen des Hollywood-Katastrophen-Genres, sondern auch des Repertoires einer filmischen Dokumentation von bedrohter Vielfalt und bedrohtem Klima, so ergeben sich einige unbequeme Parallelen: In der Wahl jeweils bildsprachlich und bildtechnisch hochgerüsteter Mittel sind sich Katastrophen-Unterhaltung und Katastrophen-Bekämpfung durchaus ähnlich. Und lassen in nicht mehr komischer Weise keine sinnvolle Alternative zu den bloßgestellten Mitteln gängiger Wissenschaftskommunikation erkennen. Gegen den selbstverschuldeten Untergang, der in Don’t Look Up mit nachhaltiger Häme und burlesker Didaktik nahegerückt wird, hilft kein Medientraining.
Julika Griem ist Professorin für Anglistische Literaturwissenschaft und seit April 2018 Direktorin des KWI.
Anmerkungen
1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/13/director-dont-look-up-climate-crisis-ending
2 Vgl. z.B. Sagan, Carl (1991): Unser Kosmos – Eine Reise durch das Weltall. Neuauflage. Droemer Knaur: München; Sagan, Carl (2001): Blauer Punkt im All. Unsere Heimat Universum. Bechtermünz: Eltville; Sagan, Carl (2001): Gott und der tropfende Wasserhahn: Gedanken über Mensch und Kosmos. Droemer Knaur: München.
3Vgl. auch https://yecaction.org.
4 Kuriose Übereinstimmung mit der Bildsprache der Weihnachtsfilme vom Aldi und Rewe 2021, im denen auch jeweils der familiäre Zusammenhalt im Angesicht der Pandemie beschworen wurde. Vielleicht nicht nur Zufall – denn auch die großen Discounter sind in ihrem Marketing sehr damit beschäftigt, sich als klimaverantwortlich zu inszenieren.
5 Lorraine Daston und Peter Galison (2010): Objectivity. New York, NY: Zone Books.
6 Vgl. FN 1.
SUGGESTED CITATION: Griem, Julika: Katastrophen-Kommunikation als Kommunikations-Katastrophe, in: KWI-BLOG, [https://blog.kulturwissenschaften.de/katastrophen-kommunikation-als-kommunikations-katastrophe/], 15.03.2022